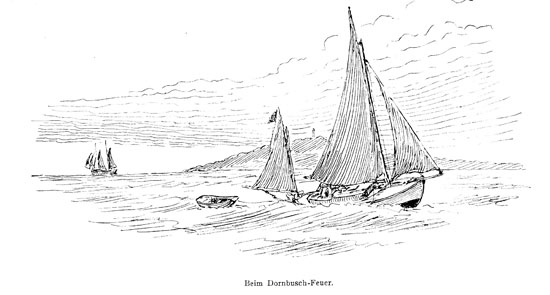Reisebriefe von P. Staerck-Coburi
Vor uns auf dem Tisch befindet sich ein Ständer mit einem Fähnlein, schwarz-weiss-rot. Alfred erinnert sich seiner verflossenen Theaterzeit und beginnt zu singen. Das ist allemal ein gefährliches Zeichen. „Wir wollen treu ergeben sein — Dir Flagge schwarz-weiss-rot! Dort kommt ein Linienschiff! Uffpassen ! Die Panzer werden gegrüsst! Flagge dippen!" Und der Kaptein dippt, d. h. er zieht die Flagge herunter und herauf. Ein sinniges Spiel. Gleich darauf kommt auch schon der Ober und erklärt uns mit satanischem Lächeln, dass wir eine Runde Bier für die Kellner zu bezahlen haben. Wer die Flagge dippt, muss berappen. Das ist zwar ein kleiner Schwindel, aber schliesslich siegt doch die Tugend. Na ja, und die Uffmachung, wie Johannes uns tröstet! Kinder, die Uffmachung! Die Kellner haben goldene Knöppe, alles ist verflucht nobel. Da müssen wir auch nobel sein! Als um halb zwölf Uhr der Spass zu Ende ist, empfindet Alfred wieder einen schamlosen Durst; er lotst uns in eine Weinstube, und als wir um halb zwei Uhr an Bord sind, muss er absolut — absolut! — noch einen Grog trinken. Nun, und soll er die einzige fühlende Brust sein? Nein! Johannes fühlt sogar sehr. Er schwärmt noch immer von seiner Leipzigerin, die er andauernd sein ,,Leipziger Allerlei" nennt. Der Grog ist alle, wir liegen in den Kojen, und Johannes ist noch immer begeistert. Ja, sein „Allerlei", das sei ein wirkliches Allerlei gewesen. O was habe sie so allerlei gehabt! So allerlei! Hm! Hm! Hm!
Bornholm.
Hammerhafen, 5. Juli 1909. Eine brillante Fahrt, die am 3. Juli! Von Sassnitz an lagen wir auf Steuerbordseite bis Bornholm. Als wir uns Roenne nähern, kommt uns das Lotsenboot entgegen mit der Lotsenflagge am Heck. Der Lotse kommt an Bord und führt Isolde sicher in den verzwickten Hafen. Ohne jeden Aufenthalt sind wir in einer Viertelstunde fest vertaut, wir machen uns landfein und bummeln durch das dänische Städtchen, das 9000 Einwohner zählt und der bedeutendste Ort der Insel ist. Es ist schon ziemlich spät, immerhin aber doch hell genug, um den Charakter der Stadt kennen zu lernen. Sauberkeit, meist einstöckige Häuser mit vielen Fenstern, etwas nüchtern, aber originell. Ohne viele Mühe verdeutschen wir uns die dänischen Inschriften. Johannes und ich konstatieren, dass es auch in Roenne hübsche Mädchen gibt, und Alfred konstatiert, dass er auf jeden Fall meuchlings sterben würde, wenn er nicht innerhalb der nächsten zehn Minuten einen Schoppen Bier bekäme. Mit Kennerblick macht er eine vertrauenswürdige Kneipe aus, in der wir auch wirklich „Oel" (Bier) bekommen. Es ist teuer, 25 Oere, dafür sind einige „Smerbrots" (Butterbrote) desto billiger und ausgezeichnet. Die Verständigung mit den intelligenten Dänen ist amüsant und geht ganz glatt, trotzdem eigentlich nur Johannes über einen kleinen dänischen Sprachschatz verfügt. Viel kann er auch nicht, ja wir haben ihn sogar im Verdacht, dass es schwedisch ist und gar nicht dänisch. Um 11 Uhr wird die Bude zugemacht. Kinder, seid ihr solide! Also gähn wi to Hus!
Am 4. Juli, Sonntag, werden morgens Einkäufe gemacht, trotzdem es Sonntags geschlossen ist, und mittags setzen wir Segel. Der Hafen ist verzwickt, um tausend Ecken geht's herum, klein ist er auch. Mit Mühe nur kommen wir heraus. Weiter geht die Reise, nach Hammerhafen. Jetzt wird Bornholm interessant. Das flache Roenne-Ufer steigt an zu gebirgsartiger Höhe, Mühlen und Dörfer fliegen an uns vorüber. Steil, in dunklen Felsenklippen fällt die Küste ab in das wogende Meer. Hammershus kommt in Sicht, das uralte, weltberühmte Schloss an der See. Mächtig ragen die gewaltigen Türme in die blaue Luft, ernst und herb, nordisch wie das ganze Bornholm.
Auf mich machte Bornholm einen grossen Eindruck. Lieblich ist es nicht, aber von stimmungsvoller, rauher Schönheit, malerisch mit seinem Granitgeröll, seinem Heidekraut und steilen Grashängen, seinen bizarren Felsengebilden, seinem nur sporadisch auftretenden Walde. Und hast du eine Höhe erstiegen zwischen Gestrüpp und riesigen Felsklötzen, blickst du immer wieder auf das unendliche Meer. Donnernd brandet es zu deinen Füssen, und weithin ziehen die Schiffe.
Bornholm besticht nicht gleich wie Rügen. Es will erobert sein. Doch wer es versteht, dem wird seine sagenhafte nordische Wildheit unvergesslich bleiben. Hammerhafen ist ja nicht gerade bedeutend, eng und wenig schön mit dem Granitwerke an der Küste, dem tiefen Staubsand der Wege. Doch bald ändert sich das Bild. Hammersoe, ein Binnensee, spiegelt die Berge wider, und gleich über dem Hafen grüsst Hammerhus, das finstere Schloss. Das lässt alles vergessen, den Staub und die wenig anmutende Ankunft. Fast eine Stunde lang zieht eine Strasse, fast immer durch Häuser, bis Allinge, über Dorf Sandvig, mit dem es zusammen 2300 Einwohner zählt. In Allinge scheint die Fremdenindustrie Bornholms sich zu konzentrieren.
Heute nachmittag wollten wir eigentlich nach Allinge fahren in den dortigen Hafen. Leider missglückte das Manöver zweimal. See und Wind stehen stark in die Hafeneinfahrt. Alfred und der „süsse Hanni" haben sich, in ihrem sportlichen Ehrgeize getroffen, dermassen darüber geärgert, dass sie sich landfein gemacht haben und spazieren gehen. Ich hüte das Haus und schreibe meinen Brief. Draussen weht eine starke Brise. Nun, hoffentlich hält der Anker. Und noch hoffentlicher können wir morgen weiter, nach Schweden und nach Kopenhagen. Gewiss ist unsere Reise schön, und die Eindrücke werden von nachhaltigster Wirkung sein. Aber sie ist auch anstrengend, und schliesslich ist es auch nicht übel, wieder der Heimat zuzufahren.

Hammerhus auf Bornholm.
Und von Kopenhagen soll es ja südwärts gehen. Nach langer Odyssee wieder zu singen: home! sweet home! — ja, das muss schön sein!
Ystad (Südschweden), 7. Juli 1909.
Ein greuliches Wetter draussen! Die Gefährten haben aus lauter Verzweiflung Oelzeug angezogen und sind in unserem Beiboot in die Stadt gefahren. Mich reizte es nicht, denn schliesslich muss man doch wieder in eine Kneipe retirieren und den guten Schweden ihr schändlich teures, aber desto minderwertigeres Bier wegzutrinken, liegt kein zwingender Grund vor. Darum bin ich solo an Bord, höre vergnügt den Regen auf das Deck trommeln und schreibe. Vorgestern also hatten wir die missglückte Ausfahrt aus Hammerhafen. Gestern früh machten wir's anders. Ein Motorboot wurde vorgespannt, sowie wir aus der engen Ausfahrt heraus waren, setzten wir Segel und flogen davon, in rascher Fahrt bei günstigem Wind und sonnigem Wetter.
Noch ist Bornholm zu sehen, als wir schon die schwedische Küste sichten. Adjüs, Bornholm! Ein anderes Bild! Ziemlich starker Seegang lässt Isolde kräftig schlingern. Des öfteren, wenn sie ihren Bug einbohrt in die Wogen, bekommen wir einige Spritzer, die lachend akzeptiert werden. Unten in der Kajüte ist's nicht auszuhalten. Das wankt und baumelt und pendelt und wackelt; stehen die Lampen schief und sind die Wände gerade oder ist's umgekehrt ? Es wird mir von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Dazu dieses infame Schlingern. Der Magen will dagegen rebellieren. Wahrscheinlich sind das Symptome der berüchtigten Seekrankheit. Sowie man wieder an Deck kommt, ist man wieder mobil.
Die Schwedische Küste rückt immer näher. Nach der Seekarte bestimmen wir den Leuchtturm von Sandhammaren, und bald sehen wir auch Ystad in der Ferne, unser heutiges Ziel. Bezaubernd ist die Küste gerade nicht. Dafür ist Ystad, wo wir gegen 5 Uhr einlaufen, ein desto netteres Städtchen, das mit seinen 9000 Einwohnern einen weit grösseren Eindruck macht. Saubere Strassen, hübsche Läden, Eisenbahn, Militär verleihen Ystad ein sympathisches und lebhaftes Gepräge. Gegend Abend bringt uns ein Spaziergang nach Saltjöbaden, einem Bad am Strand. Hier gibt's wieder Sand, den man in Bornholm vermisste, der auch in Sassnitz fehlt, und abends besuchten wir ein hübsches Konzert in einem grossen Gartenrestaurant. Es ist merkwürdig. Alles ist nicht teuer, weder die prachtvollen, raffiniert appetitlich aufgemachten Butterbrote, noch der Svenska-Punsch, noch alles übrige. Nur das Bier! Es beginnt zu regnen. Wir eilen an Bord und kommen völlig nass an. Es ist derselbe Regen, der jetzt, 14 Stunden später, noch immer heruntergiesst. Wenn das so weiter geht, kommen wir heute nicht nach Trelleborg!
Im Hafen.
Wer nicht schon einmal eine Reise mit einer 'Segelyacht mitgemacht, kann sich gar nicht denken, was für Arbeit entsteht, um in einem Hafen an- und abzukommen. Neulich, als ich die „verfluchte Schinderei" einmal satt hatte, prägte ich das Wort: Das bisschen Segeln ist reinweg Nebensache, die Hauptsache ist immer die Hafenarbeit. Erstens ist es nicht leicht, die Einfahrt zu finden, die meistens von Untiefen umgeben und durch schwimmende Bojen und Tonnen bezeichnet ist. Nun hat man sie. Ein Teil der Segel wird geborgen. Man läuft durch die Mole. Da heisst es aufpassen. Ein Liegeplatz wird im Moment erspäht. Darauf zu! Dann in den Wind gedreht. Und nun zeigt es sich,
ob man gut berechnet hat. Hat das Schiff noch soviel Fahrt, dann kommt man an. Hat man vorbeigerechnet, dann kann man sicher sein, eine, zwei, Stunden lang schuften zu müssen, ehe es sicher verholt ist. Das ist nicht gerade amüsant, und noch gemeiner ist's wenn dann zum Schluss der Hafenmeister kommt und erklärt, der Kutter könne hier nicht liegen bleiben, er müsse da und da hin. Dass dann die Mannschaft keine frommen Sprüche murmelt, ist wohl verständlich. Man kann an der Mole anlegen oder an Dükdalben festmachen oder an Bojen verholen oder ankern oder all diese Möglichkeiten miteinander verbinden. Jedenfalls fest muss das Schiff liegen und völlig sicher. Dann ist endlich die Arbeit getan, und die „crew" macht sich landfein. Nun ist das auch nicht ganz einfach, an Land zu kommen. Vom niedrigen Bord der Isolde auf das hohe Bollwerk der Mole zu klettern, ist scheusslich unbequem. Die Hände sind wieder schmutzig, und wenn man sich nicht vorsieht, so hat man bald die schönsten Teerflecken am Anzug. Hat man im Wasser festgelegt, so dient das Beiboot als Vermittler. Auch das will gelernt sein, von dem nunmehr unmenschlich hohen Bord der Isolde in das tief unten schwankende, kleine, kipplige Boot zu gelangen, ohne ins Wasser zu fallen, ohne dem, der schon unten sitzt, auf den Kopf zu treten, und ohne die heilige weisse Farbe der Isolde zu schamfielen — das ist das Schlimmste und zieht unweigerlich ein wütendes Donnerwetter seitens des Kapteins nach sich. Man lernt es aber bald, korrekt einzusteigen, wenn man nur guten Willen hat und sich nicht allzu ungeschickt anstellt. Das Boot fährt also ab. Irgend einer „ist der Dumme", wie die ständige Redensart lautet, der rudert. Und nun, denkt der Laie, sind die Schwierigkeiten vorbei. Noch lange nicht. Geht irgendwo eine Treppe ins Wasser, so ist sie hoch und schwer zu erreichen. Meistens ist aber keine Treppe da, und da heisst es wieder an den Balken der Mole hinaufturnen, an einer Anlegebrücke Kletterübungen machen, das Boot auf den Strand auflaufen lassen und mit kühnem Satz an Land zu springen. Endlich ist man da; man schimpft über die Hände, den Anzug, wischt sich ab und geht seinem Vergnügen nach. Es ist erklärlich, dass das Amüsement immer in gewissen Grenzen bleiben muss. Denn als Schreckgespenst droht zuletzt das Anbordgehen, was wieder schwierig ist und jedenfalls von einem zu sehr Angeheiterten kaum glücklich auszuführen ist. Das sind so kleine, nebensächliche Freuden, die schon ganz selbstverständlich geworden sind. Am schwersten von allen Arbeiten im Hafen ist das Herausgehen. Stehen Wind und Seegang in der Einfahrt, ist's einem Segelschiff fast unmöglich. Stundenlange Arbeit oft erfordert es, selbst unter günstigen Verhältnissen, glücklich hinauszukommen, ohne aufzulaufen, ohne mit dem Klüverbaum andere Schiffe zu kitzeln, ohne an die Mole zu rennen. Draussen winkt die See in gold'ner Sonne. Und vergessen sind die Schwierigkeiten, die strenge Arbeit des Hafens.
Seefahrt und Gesundheit.
An Bord der Isolde, 7. Juli 1909.
Ja, das ist auch ein Thema, nicht nur um einen Brief damit zu füllen, sondern um ein Buch darüber zu schreiben. Die meisten Landratten werden freilich den Kopf darüber schütteln. Seefahrt und Krankheit, nämlich Seekrankheit, davon hat man schon gehört. Und ich will auch beileibe die Erfahrungen, die ich an meinem eigenen Körper gemacht, nicht als Norm aufstellen. Es gibt genug Menschen, die nie gesund sind an Bord, ebenso gibt es aber auch Ausnahmen, und zu diesen gehört die drei Mann starke „crew" der Isolde. Von diesen soll die Rede sein. Eines ist sicher. Für den von der Geissel der Seekrankheit Verschonten kann
es gar nichts Gesünderes geben als unser Bordleben. Die Seeluft ist völlig rein, völlig staubfrei. Der ständige Wind, den der Segler haben muss, die ungehinderte Sonne tun das weitere, um den Körper von aussen günstig zu beeinflussen.
Nun die Arbeit. Gewiss eine mechanische, rein körperliche, abgesehen von der Navigation. Diese Arbeit konzentriert sich nur auf Stunden, sie genügt aber, um die Glieder gelenkig zu machen. Die Unbequemlichkeiten der niederen Kajüte, in der man eben stehen kann, der steilen Treppe nach Deck, das ewige Sich-Bücken unter allerlei harten Gegenständen, die auch nicht gerade schwellenden Lager des Nachts, wo man meist nicht weiss, welche Seite weher tut, back- oder steuerbord, das rauhe Pflichtgefühl, mit dem jeder seine Schuldigkeit tut, die Vorsicht auf dem glatten Deck, das, ohne hohe Reeling, jeden bei falschem Tritt über Bord fallen lässt, die stete Aufmerksamkeit, die einfache Kost härten ab, lassen das „Zivilleben", dem man freiwillig für einige Zeit entsagt, in einem geradezu märchenhaften Schimmer erscheinen. Vielleicht kommt auch noch dazu der mangelnde Umgang mit Frauen. Männer untereinander, auf einen kleinen Raum wochenlang beschränkt, sind nicht überzart. (Fortsetzung folgt.)